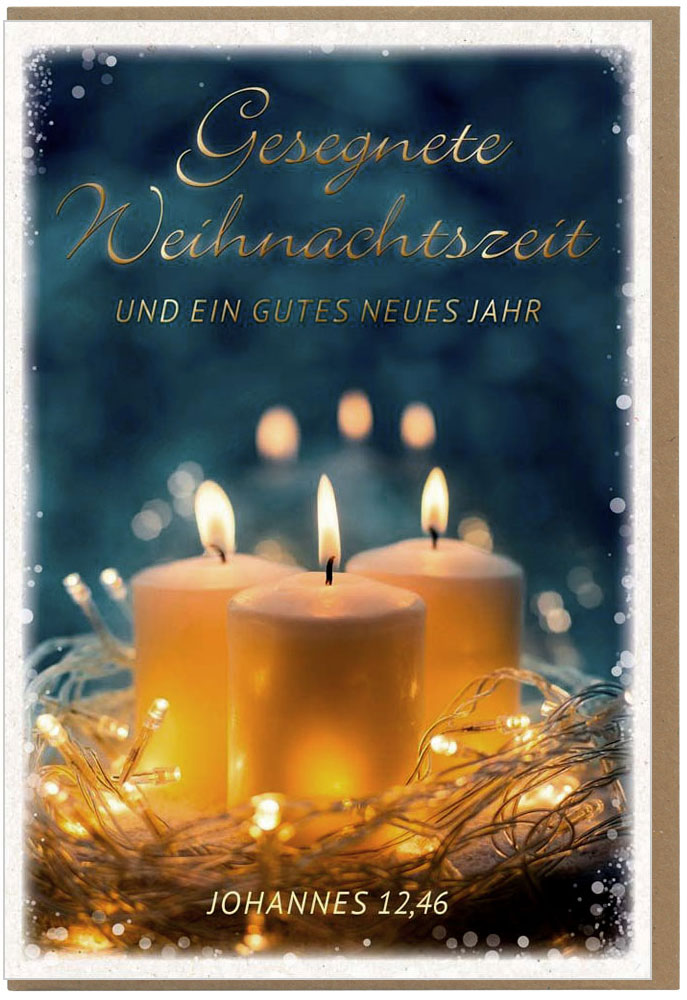Weihnachten ist für die meisten Menschen in Deutschland und vielen westlichen Ländern untrennbar mit dem 24. und 25. Dezember verbunden. Die Vorstellung, dass Weihnachten auch am 7. Januar gefeiert werden könnte, mag auf den ersten Blick verwirrend wirken. Doch genau dieses Datum, der 7. Januar, ist für Millionen von orthodoxen Christen weltweit der eigentliche Weihnachtstag. Dieses Phänomen, oft als „Weihnachten 07.01“ bezeichnet, offenbart eine faszinierende Geschichte von Kalenderreformen, tief verwurzelten Traditionen und einer Spiritualität, die sich von kommerziellen Einflüssen weitgehend abgrenzt.
Die Kalender-Diskrepanz: Julianisch vs. Gregorianisch
Der Kern des Datumsunterschieds liegt in der Verwendung zweier unterschiedlicher Kalendersysteme: dem Julianischen und dem Gregorianischen Kalender. Der Julianische Kalender wurde im Jahr 45 v. Chr. von Julius Cäsar eingeführt und war über Jahrhunderte der Standard in Europa. Er basiert auf einer Jahreslänge von 365,25 Tagen, was jedoch eine leichte Abweichung von der tatsächlichen Länge eines Sonnenjahres (ca. 365,2425 Tage) aufweist. Über die Jahrhunderte summierte sich diese kleine Differenz, sodass der Julianische Kalender dem tatsächlichen astronomischen Jahr um mehrere Tage vorauslief.
Um diese Ungenauigkeit zu korrigieren und die Übereinstimmung mit den astronomischen Ereignissen (insbesondere der Tagundnachtgleiche für die Bestimmung des Osterdatums) wiederherzustellen, führte Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 den Gregorianischen Kalender ein. Dieser neue Kalender passte die Schaltjahresregelung an und korrigierte die aufgelaufene Differenz, indem er 10 Tage übersprang. Die meisten katholischen und protestantischen Länder übernahmen den Gregorianischen Kalender relativ schnell.
Die orthodoxen Kirchen jedoch, die sich bereits im Großen Schisma von 1054 von der westlichen Kirche getrennt hatten, lehnten die Kalenderreform des Papstes aus Rom ab. Sie sahen darin einen Eingriff in ihre Traditionen und eine Autoritätsanmaßung. Viele orthodoxe Kirchen, insbesondere die Russisch-Orthodoxe, Serbisch-Orthodoxe, Georgisch-Orthodoxe und das Patriarchat von Jerusalem, halten bis heute am Julianischen Kalender für die Berechnung ihrer religiösen Feste fest. Da sich die Differenz zwischen den beiden Kalendern im Laufe der Jahrhunderte weiter vergrößert hat (alle 100 Jahre um einen Tag, außer bei durch 400 teilbaren Jahrhundertjahren), beträgt sie heute 13 Tage. Somit fällt der 25. Dezember des Julianischen Kalenders auf den 7. Januar des Gregorianischen Kalenders.
Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle orthodoxen Kirchen dem Julianischen Kalender folgen. Einige, wie die Griechisch-Orthodoxe Kirche (mit Ausnahme des Patriarchats von Jerusalem und des Athos), die Rumänisch-Orthodoxe Kirche und die Bulgarisch-Orthodoxe Kirche, haben den „Neuen Julianischen Kalender“ übernommen, der mit dem Gregorianischen Kalender für feste Feste übereinstimmt, aber weiterhin die orthodoxe Osterberechnung verwendet. Für sie findet Weihnachten also ebenfalls am 25. Dezember statt. Doch für die Mehrheit der orthodoxen Gläubigen, insbesondere in den großen slawischen Ländern, bleibt der 7. Januar der Heilige Tag.
Die Vorbereitung: Das Philippsfasten
Die Feierlichkeiten von Weihnachten 07.01 sind tief in der orthodoxen Spiritualität verwurzelt und unterscheiden sich in ihrer Vorbereitung und Ausgestaltung erheblich von den westlichen Bräuchen. Im Gegensatz zur oft konsumorientierten Vorweihnachtszeit im Westen steht im orthodoxen Glauben das „Philippsfasten“ (auch als Weihnachtsfasten oder Vierzig-Tage-Fasten bekannt) im Vordergrund. Dieses Fasten beginnt am 28. November und dauert bis zum 6. Januar, dem orthodoxen Heiligen Abend.
Das Philippsfasten ist eine Zeit der geistigen Reinigung und der Vorbereitung auf die Geburt Christi. Es ist eine Periode der Enthaltsamkeit von bestimmten Nahrungsmitteln – Fleisch, Milchprodukte und Eier sind verboten, und an bestimmten Tagen auch Fisch, Wein und Öl. Die Strenge des Fastens variiert je nach Tradition und individueller Frömmigkeit, aber der Sinn bleibt derselbe: die Seele durch Verzicht und Gebet zu läutern, um die Ankunft des Erlösers würdig zu empfangen. Es ist eine Zeit, in der die Gläubigen dazu angehalten sind, sich von weltlichen Ablenkungen zu lösen und sich auf das Wesentliche zu besinnen: die spirituelle Bedeutung der Menschwerdung Gottes.
Neben der Ernährungsumstellung ist das Fasten auch eine Zeit der erhöhten Gebete, der Beichte und der guten Werke. Es geht darum, nicht nur den Körper, sondern auch den Geist zu reinigen, um mit einem reinen Herzen das große Fest zu begrüßen. In dieser Zeit werden die Kirchen häufiger besucht, und die Gläubigen bereiten sich intensiv auf die Beichte und die Heilige Kommunion vor, die oft in der Weihnachtsliturgie empfangen wird.
Der Heilige Abend (Sochelnik) am 6. Januar
Der Höhepunkt der Vorbereitung ist der 6. Januar, der orthodoxe Heilige Abend, der in vielen slawischen Ländern als „Sochelnik“ bekannt ist. Dieser Tag ist geprägt von strengem Fasten, das oft bis zum Erscheinen des ersten Sterns am Abendhimmel dauert – ein Symbol für den Stern von Bethlehem, der den Weisen den Weg zur Krippe wies.
Die wichtigste Tradition des Sochelnik ist das „Heilige Abendmahl“ (Svjata Vecherya oder Velija Kutia), eine feierliche Mahlzeit, die nach dem Erscheinen des ersten Sterns eingenommen wird. Diese Mahlzeit ist rein vegetarisch und vegan, um das Fasten bis zum Weihnachtstag aufrechtzuerhalten. Sie besteht traditionell aus zwölf Gerichten, die die zwölf Apostel Christi symbolisieren.
Das zentrale Gericht ist „Kutia“ (oder Koliva), ein süßer Brei aus Weizen, Mohn, Honig, Nüssen und Trockenfrüchten. Weizen symbolisiert die Auferstehung und das ewige Leben, Mohn steht für Fruchtbarkeit und Honig für die Süße des Paradieses und die Gnade Gottes. Weitere typische Gerichte sind „Uzvar“ (ein Kompott aus getrockneten Früchten), Borschtsch ohne Fleisch, Vinaigrette (ein Salat aus Roter Bete, Kartoffeln und Bohnen), Pilzgerichte, Fisch (manchmal erlaubt, je nach Tradition) und verschiedene Brotsorten.
Vor dem Essen wird oft ein Gebet gesprochen, und es ist üblich, etwas Stroh unter die Tischdecke zu legen, um an die Krippe in Bethlehem zu erinnern. Manchmal wird auch eine Knoblauchzehe in die Ecken des Tisches gelegt, um böse Geister abzuwehren und Gesundheit zu wünschen. Die Atmosphäre ist feierlich und besinnlich, ein starker Kontrast zur oft lauten und kommerziellen Weihnachtsstimmung im Westen.
Nach dem Abendessen begeben sich viele Gläubige zur Mitternachtsliturgie in die Kirche. Diese feierliche „Göttliche Liturgie“ ist der Höhepunkt der Weihnachtsnacht und zelebriert die Geburt Christi mit prächtigen Gesängen, Weihrauch und tiefem Gebet. Die Kirchen sind festlich geschmückt, oft mit einer Krippe, die die Geburt Jesu darstellt. Die Liturgie dauert oft mehrere Stunden und ist ein tief spirituelles Erlebnis, das die Gläubigen auf die Ankunft des Erlösers einstimmt.
Der Weihnachtstag am 7. Januar
Der 7. Januar ist der eigentliche Weihnachtstag, der Tag der Geburt Christi. Nach der Mitternachtsliturgie oder einer Morgenliturgie wird das Fasten gebrochen. Dies ist der Moment, in dem die festliche Mahlzeit beginnt, die nun auch Fleisch, Milchprodukte und andere zuvor verbotene Speisen umfasst. Die Familien kommen zusammen, um gemeinsam zu feiern und die reichhaltigen Speisen zu genießen.
Im Gegensatz zum westlichen Weihnachten, wo die Bescherung oft im Mittelpunkt steht, ist die Geschenkübergabe im orthodoxen Weihnachten weniger zentral und oft bescheidener. Manchmal werden Geschenke am Neujahrstag (nach dem Gregorianischen Kalender) oder am Dreikönigstag (Epiphanias, am 19. Januar im Julianischen Kalender) überreicht. Der Fokus liegt stattdessen auf der Familie, der Gemeinschaft und der spirituellen Bedeutung des Festes.
Ein wichtiger Brauch, der in vielen orthodoxen Ländern gepflegt wird, ist das „Kolyadki“ – das Singen von Weihnachtsliedern. Gruppen von Kindern und Erwachsenen ziehen von Haus zu Haus, singen traditionelle Lieder, die die Geburt Christi preisen, und erhalten dafür kleine Gaben wie Süßigkeiten oder Geld. Dies ist eine fröhliche Tradition, die die Gemeinschaft stärkt und die Botschaft von Weihnachten verbreitet.
Die Zeit nach Weihnachten: Svyatki und Epiphanias
Die Weihnachtsfeierlichkeiten enden nicht am 7. Januar. Die Zeit zwischen dem Weihnachtstag und dem Dreikönigstag (Epiphanias oder Taufe Christi) am 19. Januar wird als „Svyatki“ (die Zwölften) bezeichnet. Diese Periode ist eine Zeit der Freude, des Feierns und der Besuche bei Freunden und Verwandten. Es ist eine Zeit, in der das Fasten aufgehoben ist und die Menschen die Geburt Christi in vollen Zügen genießen.
Der 19. Januar, der orthodoxe Dreikönigstag oder Epiphanias (Theophanie), ist ein weiteres wichtiges Fest. Es erinnert an die Taufe Jesu im Jordan und die Offenbarung der Heiligen Dreifaltigkeit. An diesem Tag findet oft eine feierliche Wasserweihe statt, bei der Flüsse, Seen oder andere Gewässer gesegnet werden. Viele Gläubige tauchen trotz eisiger Temperaturen in die geweihten Gewässer, um sich von Sünden zu reinigen und Gesundheit zu erlangen.
Kulturelle Bedeutung und Herausforderungen
Weihnachten 07.01 ist nicht nur ein religiöses Fest, sondern auch ein tief verwurzeltes kulturelles Ereignis, das die Identität vieler orthodoxer Völker prägt. Es ist ein Fest, das trotz historischer Umbrüche, wie der sowjetischen Ära, in der Religion unterdrückt wurde, überlebt hat. In vielen ehemals kommunistischen Ländern erlebte die orthodoxe Weihnacht nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eine Renaissance und wird heute wieder offen und enthusiastisch gefeiert.
Die Koexistenz von Gregorianischem Neujahr und Julianischem Weihnachten führt in vielen orthodoxen Ländern zu einer einzigartigen Feiertagsabfolge. Oft wird zuerst das säkulare Neujahr am 1. Januar gefeiert, das in vielen Familien zu einem großen Fest mit Geschenken geworden ist, da die Weihnachtszeit dem Fasten gewidmet ist. Erst danach folgt die besinnlichere und religiösere Feier von Weihnachten 07.01. Diese Abfolge ermöglicht es den Menschen, sowohl weltliche Freude als auch tiefe Spiritualität zu erleben.
Fazit
Weihnachten 07.01 ist weit mehr als nur ein verschobenes Datum im Kalender. Es ist ein lebendiges Zeugnis einer tiefen religiösen Tradition, die sich über Jahrhunderte bewahrt hat. Es ist ein Fest, das weniger von kommerziellem Glanz und mehr von spiritueller Besinnung, familiärer Wärme und gemeinschaftlichem Zusammenhalt geprägt ist. Für Millionen von orthodoxen Christen weltweit ist der 7. Januar der Tag, an dem sie die wundersame Geburt Christi feiern – eine Feier, die in ihrer Schlichtheit und ihrem Fokus auf das Wesentliche eine besondere Schönheit und Tiefe besitzt. Das Verständnis dieses Datums und der damit verbundenen Bräuche eröffnet einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der christlichen Welt und erinnert uns daran, dass Glaube und Tradition in unzähligen Formen Ausdruck finden können.